Begriffe - Brandverhalten und Feuerwiderstand

In der modernen Bauindustrie ist der Brandschutz eine der wichtigsten Qualitätsanforderungen, insbesondere weil Holz und Holzmaterialien immer häufiger verwendet werden. Häufig entsteht jedoch Verwirrung zwischen den beiden wichtigen Brandschutzbegriffen Brandverhalten und Feuerwiderstand. Obwohl diese miteinander verbunden sind, beziehen sie sich auf völlig unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen in Bezug auf Baumaterialien und Konstruktionen. Im Folgenden erklären wir, was jeder Begriff bedeutet, wie sie in Europa bewertet werden und warum beide im heutigen Bauwesen wichtig sind.
Was ist das Brandverhalten?
Das Brandverhalten beschreibt das Verhalten eines Materials im Kontakt mit Feuer, d.h., wie leicht das Material entzündet wird, wie schnell die Flammen über seine Oberfläche ausbreiten und wie viel Wärme, Rauch und brennende Tropfen das Material bei der Verbrennung freisetzt. Dies ist im Wesentlichen die Eigenschaft des Materials, auf Feuer zu reagieren (engl. reaction to fire), die bestimmt, in welchem Ausmaß das Material die Feuerausbreitung vor dem Entstehen eines allgemeinen Raumbrandes (Flashover) fördert. In Europa gilt dafür der harmonisierte Klassifizierungsstandard EN 13501-1, der Materialien hinsichtlich des Brandverhaltens in sieben Euroklassen unterteilt: A1, A2, B, C, D, E, F. Von nicht brennbar (A1) bis leicht entflammbar (F). Zusätzlich zur Hauptklasse werden zwei Unterindizes hinzugefügt: s (Rauchentwicklung) und d (Bildung brennender Tropfen).
Die Klasse B-s1,d0 ist die höchste Brandschutzklasse für Holz, was bedeutet: B - das Material ist schwer entflammbar (trägt sehr wenig zum Feuer bei), s1 - es entsteht sehr wenig Rauch, d0 - es entstehen keine brennenden Tropfen oder Partikel. Praktisch gesehen bedeutet dies, dass, wenn das Holzmaterial mit einem entsprechenden Brandschutzmittel behandelt wird und die Klasse B-s1,d0 erreicht wird, die Feuerausbreitung über die Oberfläche erheblich verlangsamt wird und nur minimale Mengen an Rauch entstehen. Dies gibt den Menschen im Gebäude mehr Zeit zur Evakuierung und den Rettungskräften mehr Zeit, auf den Brand zu reagieren. Europäische Bauvorschriften fordern oft genau diese Klasse für Holzoberflächen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Ohne Brandschutzbehandlung ist unbehandeltes Holz meist in der Klasse D oder E.
Was ist die Feuerwiderstandsklasse? (REI-Klassen)
Die Feuerwiderstandsklasse (engl. fire resistance) charakterisiert die Fähigkeit einer Baukonstruktion, während eines Brandes über einen bestimmten Zeitraum ihre Tragfähigkeit, Feuer- und Rauchdichtigkeit sowie Wärmeisolierung zu bewahren. Der Feuerwiderstand wird normalerweise durch die Kombination der Buchstaben REI zusammen mit der Anzahl der Minuten ausgedrückt, die die Widerstandsfähigkeit anzeigt. Die Buchstaben REI stehen für die Hauptindikatoren der Feuerbeständigkeit einer Konstruktion:
- R (Resistance) - Erhaltung der Tragfähigkeit: Die Konstruktion muss unter Einwirkung von Feuer eine vorgegebene Last tragen, ohne einzustürzen.
- E (Integrity) - Integrität (Dichtigkeit): Die Konstruktion muss nicht durchbrennen, wobei weder Flammen noch heiße Gase von der feuerexponierten Seite durch die Konstruktion dringen dürfen.
- I (Insulation) - Isolierfähigkeit: Wärmeisolierung, bei der die Temperatur auf der feuerabgewandten Seite der Konstruktion nicht gefährlich hoch ansteigen darf und eine übermäßige Wärmeübertragung verhindert wird.
Zum Beispiel bedeutet die Klasse REI 60, dass die Konstruktion in einem standardisierten Brandtest mindestens 60 Minuten standhalten muss, während dieser Zeit die erforderliche Tragfähigkeit (R), Feuer- und Rauchdichtigkeit (E) sowie Wärmeisolierung (I) aufrechterhalten werden. Mit anderen Worten, innerhalb von 60 Minuten nach Beginn des Brandes darf eine Wand, Decke oder Balkenkonstruktion nicht einstürzen, durchbrennen oder Wärme auf die andere Seite der Konstruktion übertragen, um benachbarte Räume zu entzünden. Verschiedene Gebäude erfordern unterschiedliche Feuerwiderstandszeiten gemäß den Normen, normalerweise sind diese 30, 60, 90 Minuten oder mehr, abhängig vom Gebäudetyp und seiner Nutzung. Das Ziel des Feuerwiderstands ist es sicherzustellen, dass die Konstruktion lange genug stabil bleibt, um die Evakuierung und das Löschen des Feuers in dieser Zeit zu ermöglichen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass der Feuerwiderstand eine Eigenschaft der gesamten Konstruktion ist, nicht eine Eigenschaft eines einzelnen Materials (zum Beispiel Holz). Daher können viele Faktoren - Materialtyp, Querschnitt, Schutzschichten - beeinflussen, wie lange eine Wand oder ein Balkensystem dem Feuer standhalten kann. Zum Beispiel können massive Wandelemente aus dickem Brettschichtholz oder CLT (kreuzverleimtes Holz) aufgrund ihrer Massivität eine überraschend hohe Feuerwiderstandsfähigkeit erreichen: Eine dreilagige massive CLT-Platte kann ohne Verkleidung etwa REI 30 erreichen, da die oberste Holzschicht verkohlt und die inneren Schichten zur Erhaltung der Tragfähigkeit schützt. Allerdings muss auch ein solches Element schließlich der Hitze nachgeben, wenn das Feuer länger dauert als seine natürliche Feuerwiderstandszeit.
Was sind die K-Klassen (zum Beispiel K1 10, K2 30)?
Zusätzlich zu den REI-Klassen werden im Brandschutz von Holzgebäuden häufig K-Klassen verwendet, die die Feuerbeständigkeit der Oberflächenbeschichtung eines Gebäudes kennzeichnen. Die K-Klasse (manchmal auch als Schutzschichtklasse bezeichnet) zeigt, wie lange eine Wand- oder Deckenbeschichtung die darunter liegende Konstruktion vor Entzündung und Erwärmung schützen kann. Dies ist besonders wichtig bei Holztragkonstruktionen. Eine K-Klasse-Beschichtung fungiert quasi als eine Art Opferschicht, die die ersten Schläge des Feuers auf sich nimmt und die Konstruktion für eine Weile unberührt lässt. Die Norm EN 13501-2 definiert zwei Kategorien: K1 und K2, und Zeitintervalle von 10, 30 oder 60 Minuten. Abhängig von den Testbedingungen und der Untergrundbeschaffenheit wird das Beschichtungsmaterial wie folgt klassifiziert: K1 10 oder K2 10, K2 30, K2 60 usw. Hier steht die Zahl für die Minuten, während denen die Beschichtung Schutz bieten muss, während K1 vs K2 darauf hinweist, auf welchen Untergründen und unter welchen Bedingungen der Test durchgeführt wurde (K1 ist eine strengere Klasse mit begrenztem Untergrund und K2 ist allgemeiner).
Praktische Beispiele: Bei einer Beschichtungsart der Klasse K2 10 muss die Oberflächenbeschichtung sicherstellen, dass die Temperatur unmittelbar hinter der Beschichtung innerhalb von 10 Minuten nach Beginn des Brandes nicht gefährlich hoch ansteigt und das darunter liegende Material nicht entzündet. K2 30 erfordert 30 Minuten Schutz und K2 60 mindestens 60 Minuten Schutz. Wenn zum Beispiel an einer Wand eine Schutzschicht der Klasse K2 60 (z.B. eine spezielle feuerfeste Gipskartonplatte) angebracht ist, muss diese Schicht 60 Minuten lang in Position bleiben, ohne durchzubrennen und die Temperatur dahinter unter Kontrolle zu halten. Die durchschnittliche Temperatur auf der Oberfläche der Konstruktion hinter der Beschichtung darf die Umgebungstemperatur nicht um mehr als 250 °C überschreiten. Auch darf das Material hinter der Beschichtung (z.B. eine Holzoberfläche) am Ende des Tests nicht entzündet oder verkohlt sein.
Die Bedeutung der K-Klassen für Holz: Bei Holzkonstruktionen bedeutet dies, dass zum Beispiel eine Gipskartonplatte oder eine andere feuerfeste Verkleidung als Schutzschicht fungiert und dem Holz zusätzliche Zeit verschafft, bevor das Feuer das Holz selbst entzünden oder seine Tragfähigkeit schwächen kann. Oft wird in mehrgeschossigen Holzgebäuden gefordert, dass Holzbalken und -wände mit einer K 230 oder K 260 Klasse Verkleidung versehen werden, um den erforderlichen Feuerwiderstand zu erreichen. Studien und Tests haben gezeigt, dass sogar eine ausreichend dicke Holzverkleidung selbst als Brandschutzbeschichtung fungieren kann: Zum Beispiel entspricht eine 27 mm dicke Vollholzverkleidung der Klasse K 230, und zwei Schichten solcher Verkleidung (Gesamtdicke ~54 mm) können Schutz für 60 Minuten bieten, also im Rahmen der Klasse K2 60. Es wurde auch festgestellt, dass das Hinzufügen einer Schicht Gipskartonplatte (feuerfeste Gipskartonplatte) zu einer CLT-Wand dessen Feuerwiderstandsfähigkeit um etwa das Eineinhalbfache erhöht. Wenn das Element ohne Beschichtung REI 60 war, wurde mit einer Schicht Gipskartonplatte REI 90 erreicht, was die Effektivität der K-Klasse-Beschichtung veranschaulicht.
Wie beeinflussen Brandverhalten und Feuerwiderstand zusammen die Brandsicherheit?
Brandverhalten und Feuerwiderstand sind die zwei Seiten der Brandsicherheit eines Gebäudes, die sich gegenseitig ergänzen. In einem Gebäude mit hohem Brandschutzniveau müssen die Materialien und Konstruktionen beiden Aspekten gerecht werden:
- Eine gute Brandverhaltensklasse bedeutet, dass das Material nicht leicht entzündet wird und das Feuer nicht schnell ausbreitet und somit die Entwicklung des Feuers im Gebäude in der Anfangsphase eines Brandes verlangsamt, was den Menschen Zeit zur Flucht gibt und den Schaden begrenzt.
- Eine gute Feuerwiderstandsklasse bedeutet, dass, auch wenn der Brand andauert, die Struktur des Gebäudes lange genug erhalten bleibt, um die Ausbreitung des Feuers in andere Räume zu verhindern und den Einsturz des Gebäudes zu verhindern.
Es ist wichtig zu verstehen, dass diese beiden Eigenschaften bei Materialien unterschiedlich ausgeprägt sein können und beide gewährleistet sein müssen.
Ein Beispiel hierfür ist der Vergleich zwischen Stahl und Holz. Stahl ist als Material nicht brennbar und gehört daher gemäß der Euroklasse zur Klasse A1 (ausgezeichnet hinsichtlich der Brandreaktion - trägt im Allgemeinen nicht zur Brandausbreitung bei). Doch verliert eine ungeschützte Stahlkonstruktion bereits bei etwa 500 °C etwa die Hälfte ihrer Festigkeit und erhitzt sich bei einem Brand sehr schnell. Ohne zusätzlichen Schutz kann eine Stahlkonstruktion daher innerhalb kürzester Zeit versagen - sie erfüllt somit nicht die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer, obwohl sie der Reaktionsklasse A1 entspricht.
Holz hingegen ist ein brennbares Material (z. B. ist Fichte in Euroklasse D eingestuft - relativ leicht entflammbar), doch ein massiver Holzträger oder ein CLT-Panel verkohlt an der Oberfläche und kann seine Tragfähigkeit im Brandfall überraschend lange aufrechterhalten - oft sogar länger als ungeschützter Stahl, bevor das Element vollständig durchbrennt. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen Holzbalken nach einem Brand noch tragfähig waren, während benachbarte ungeschützte Stahlträger einstürzten. Dieses Beispiel verdeutlicht: Eine gute Brandreaktionsklasse bedeutet nicht automatisch eine gute Feuerwiderstandsdauer - und umgekehrt. Daher müssen Planer und Ingenieure stets beide Aspekte berücksichtigen.
In der Praxis bedeutet dies, dass bei Holzbauten Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Entflammbarkeit des Holzes zu reduzieren (z. B. durch Imprägnierung mit Brandschutzmitteln, Einsatz nicht brennbarer Oberflächenbeschichtungen) und gleichzeitig die konstruktive Feuerwiderstandsdauer sichergestellt werden muss (z. B. durch größere Querschnitte, die eine schützende Verkohlungsschicht bilden, oder durch den Schutz tragender Teile mit Gipskartonplatten). Die europäischen Bauvorschriften enthalten Anforderungen sowohl an die Brandklasse der Materialien als auch an die Feuerwiderstandsfähigkeit der Konstruktionen. In vielen Fällen muss deshalb eine ganzheitliche Lösung geplant werden, die beide Anforderungen erfüllt.
Beispiel: Bei Deckenbalken in einem Holzbau kann die Lösung so aussehen, dass die Balken selbst ausreichend dimensioniert und gegebenenfalls behandelt sind, um die Tragfähigkeit R60 zu erreichen, und zusätzlich an der Unterseite mit einem B-s1, d0-klassifizierten Brandschutzanstrich oder einer Gipskartondecke mit der Klassifizierung K2 30 versehen sind - so wird sowohl die Brandausbreitung begrenzt als auch die Tragkonstruktion für mindestens 30 Minuten geschützt.
Fachleute betonen, dass keiner der beiden Aspekte unterschätzt werden darf. Wenn ein Material schnell entflammbar ist und das Feuer rasch weiterleitet (schlechte Brandreaktion), kann sich ein Brand ausbreiten, bevor die strukturelle Feuerwiderstandsfähigkeit überhaupt eine Rolle spielt. Umgekehrt: Ist ein Material zwar nicht brennbar, aber die Konstruktion schwach, kann ein Gebäude einstürzen, bevor das Feuer sich überhaupt ausbreitet. Deshalb müssen Materialien und Baulösungen stets so ausgewählt werden, dass sie sowohl im Hinblick auf Brandreaktion als auch auf Feuerwiderstand getestet und den spezifischen Anforderungen angepasst sind.
Zusammenfassung
Brandreaktion und Feuerwiderstand sind zwei unterschiedliche Kennwerte der Brandsicherheit: Der erste beschreibt, wie stark ein Material zur raschen Brandausbreitung beiträgt, der zweite, wie lange eine Konstruktion dem Feuer standhält. Bei zunehmendem Einsatz von Holzmaterialien ist die Unterscheidung dieser Begriffe von großer Bedeutung. Für eine hohe Brandsicherheit müssen sowohl die Brandausbreitung begrenzt (gute Euroklasse) als auch die strukturelle Stabilität erhalten bleiben (ausreichender REI-Wert).
Zudem müssen bei Holzbauten auch die K-Klassen berücksichtigt werden, die eine dritte Dimension darstellen - nämlich die Dauer, für die eine Schutzschicht das Eindringen des Feuers in die Konstruktion verzögern kann. Wenn alle drei Aspekte - Brandreaktion, Feuerwiderstand und Dauer des Oberflächenschutzes - berücksichtigt werden, kann Holz auch in höheren Gebäuden ein sehr sicheres und widerstandsfähiges Baumaterial sein.
Positiv ist, dass neue Technologien und Produkte Holz immer feuerbeständiger machen. Beispielsweise gibt es innovative Flammschutzmittel wie SPFR100, das Holz die höchste Brandreaktionsklasse (B-s1,d0) verleiht und auch die Einhaltung von K-Klassenanforderungen erleichtert - und das auf umweltfreundliche Weise bei Erhalt der natürlichen Ästhetik des Holzes.
Mit solchen Lösungen lässt sich in Europa die architektonische Attraktivität und Nachhaltigkeit von Holz mit hohen Brandschutzanforderungen in Einklang bringen - ein immer wichtigeres Kriterium für Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit.
Letztlich stellt die Kombination von Anforderungen an Brandreaktion und Feuerwiderstand sicher, dass im Brandfall Zeit bleibt, Menschenleben zu retten, und dass die Gebäudestruktur genügend Widerstand bietet, um den Brand unter Kontrolle zu bringen, bevor das gesamte Gebäude zerstört wird.


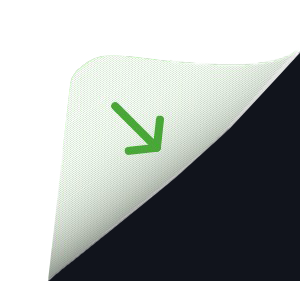
 +372 5686 4224
+372 5686 4224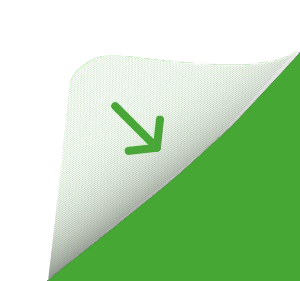
.png)
 raido@solidprotect.eu
raido@solidprotect.eu.png)
.png)
 +372 5695 2333
+372 5695 2333